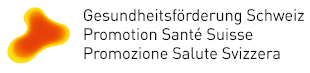PPD bei Migrantinnen und Migranten

Überall auf der Welt, in allen Nationen und Ländern, leiden Menschen an postpartalen Depressionen (PPD). Auch wenn die Häufigkeit in einigen Regionen der Welt geringer oder höher sein mag, wird in Studien immer wieder darauf hingewiesen, dass im Durchschnitt 15 Prozent der Mütter und 10 Prozent der Väter mit dieser Krankheit konfrontiert sind (Halbreich & Karkun, 2006; Paulson & Bazemore, 2010). Wir wissen noch nicht genau, was Depressionen auslöst, aber wir kennen einige Risikofaktoren, von denen einer der stärksten eine geringe soziale Unterstützung und Stress in der jüngsten Vergangenheit ist (Ghaedrahmati & al., 2017). Dies macht Einwanderer zu einer der am stärksten gefährdeten Gruppen und die Forschung belegt dies. Je nach Studie liegt die Prävalenz von PPD bei Einwanderern und Flüchtlingen zwischen 20 und 42 % (Collins et al., 2011; Falah-Hassani et al., 2015). Wenn man bedenkt, dass ¼ der Schweizer Bevölkerung Einwanderer sind, ist das ein riesiges Problem, das angegangen werden muss.
Einwanderung als Risikofaktor für Depressionen
Der Moment, in dem wir Eltern werden, ist für jeden von uns eine neue und potenziell stressige Situation. Es ist auch der Moment, in dem wir Unterstützung benötigen, vielleicht am meisten in unserem Leben - schließlich sagt man, dass es ein Dorf braucht, um ein Kind grosszuziehen. Wir brauchen nicht nur praktische Unterstützung (z. B. bei der Aufteilung der Kinderbetreuung), sondern auch emotionale (Gefühl der Verbundenheit und Zugehörigkeit) und informationelle Unterstützung (Beratung und Bereitstellung nützlicher Informationen). In einem solchen Kontext können Eltern mit Migrationshintergrund Isolation und Einsamkeit erleben, da ihr Unterstützungssystem häufig in ihrem Herkunftsland verbleibt (Tobin et al., 2018). Die Abwesenheit von Familie und Freunden ist in den letzten Jahren aufgrund von Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und der unsicheren politischen Lage in einigen Regionen noch schwieriger geworden.
Zudem wird die Migration an sich als ein extrem belastender Anpassungsprozess beschrieben. In der Zeit nach der Geburt ist die Anpassungsleistung noch grösser, da zugewanderte Eltern in dieser Zeit beide Übergänge durchlaufen - den Übergang von "Frau/Mann" zu "Mutter/Vater" und den Übergang von "Einheimischen" zu "Einwanderern" (Barclay und Kent, 1998). Mit anderen Worten: Der Stress, den sie erleben, ist potenziell grösser, insbesondere wenn sie weniger als zwei Jahre in einem neuen Land leben (Ganann et al., 2016).
Die Anpassung an das Leben in einem neuen Land kann auf vielen Ebenen schwierig sein, um nur die Sprachbarrieren, die Anpassung an neue Wertesysteme und Lebensstile, den Minderheitenstatus und die Ausgrenzung sowie die mangelnde Kenntnis des Gesundheits, Rechts- und Verwaltungssystems zu nennen (O'Mahony et al., 2013). Stress und Sorgen können durch einen schwebenden oder unsicheren Aufenthaltsstatus noch verschärft werden (Tobin et al., 2018).
Zu bedenken ist auch, dass Depressionen in vielen Fällen bereits während der Schwangerschaft beginnen, und auch hier leiden Migrantinnen im Vergleich zu Einheimischen häufiger unter vorgeburtlichen Depressionen. Eine in Genf durchgeführte Studie mit 228 Migrantinnen im dritten Trimester der Schwangerschaft ergab, dass 37 Prozent von ihnen ein Ergebnis auf der Edinburgh Postpartum Depression Scale erzielten, das auf das Vorliegen einer Depression hindeuten könnte (Ratcliff et al., 2015). In Anbetracht der Tatsache, dass eine unbehandelte vorgeburtliche Depression zu geburtshilflichen Komplikationen führen kann sowie ein weiterer Faktor für eine PPD darstellt, sollten wir in Erwägung ziehen, Migrantinnen bereits während der Schwangerschaft auf Symptome einer Depression zu untersuchen.
An dieser Stelle dürfen wir nicht die Flüchtlinge vergessen, die eine besonders gefährdete Gruppe unter den Einwanderern darstellen. Wir müssen alle Ebenen des Stresses verstehen, den sie durchmachen - (1) sie werden Eltern, (2) sie müssen sich an ein neues Land anpassen und erfahren weniger Unterstützung, (3) zusätzlich müssen sie mit Stress umgehen, der mit früheren Erfahrungen zusammenhängt. Traumatische Ereignisse, schwierige Bedingungen während der Reise, der ausstehende Status als Asylbewerber und das Bewusstsein, dass die wirtschaftliche und politische Situation in ihrem Herkunftsland immer noch tragisch ist oder eine Bedrohung für andere Familienmitglieder/Freunde darstellt - all dies führt zu einer Anhäufung von Stress (Bogic et al., 2015).
Hindernisse für die Inanspruchnahme von Hilfe
Einerseits haben Migranten ein höheres Risiko, psychisch zu erkranken, andererseits wissen wir auch, dass sie seltener Hilfe suchen (Lindert et al., 2008). Dies stellt eine grosse Herausforderung dar, da die Symptome von PPD in dieser Gruppe bekanntermassen unterrepräsentiert sind (O'Mahony & Donnelly, 2013).
Warum ist es denn weniger wahrscheinlich, dass Zuwanderer um Hilfe bitten? Wir müssen zwei Dinge in Betracht ziehen: strukturelle Barrieren und persönliche Überzeugungen. Zur ersten Gruppe gehören Probleme wie mangelndes Wissen über die Funktionsweise des Gesundheitssystems (nicht wissen, wo man einen Spezialisten findet, welche Art von Behandlung möglich ist, wie viel die Besuche kosten, usw.), Sprachbarrieren (besonders wichtig bei regelmässiger Therapie), Einschränkungen bei der Kinderbetreuung (Eltern können Probleme haben, jemanden zu finden, der sich während der Gesundheitstermine um ihr Kind kümmert) oder begrenzte finanzielle Mittel (O'Mahony et al., 2013).
Persönliche Glaubensbarrieren sind komplizierter und basieren auf den Werten, kulturellen Normen und dem Hintergrund der Eltern. Dabei ist es wichtig, dass in einigen Kulturen das Stigma psychischer Probleme stärker ausgeprägt ist. Eltern glauben möglicherweise, dass sie Schande über ihre Familie und Gemeinschaft bringen, wenn sie um Hilfe bitten (Kirmayer et al., 2011). Einige Einwanderer verstehen das Konzept der PPD nicht oder haben in ihrer Sprache nicht einmal ein Wort für die Krankheit (Tobin et al., 2018). Andere haben Angst, ihre Kinder an die Behörden zu verlieren. Einige glauben, dass Fachärzte keine Zuwanderer als neue Patienten aufnehmen wollen (Edge & MacKian, 2010). Ein weiterer Fehlglaube darin besteht, dass gewisse Einwanderer Angst haben, bei einer psychischen Diagnose weniger Chancen auf eine Statusänderung oder Einwanderung haben. All diese Überzeugungen können dazu führen, dass sie ihre Symptome verstecken, bis sie so schlimm werden, dass sie unerträglich werden - und dies steht im grossen Widerspruch mit dem Wissen, dass eine frühzeitige frühzeitige Diagnose für eine leichtere Behandlung entscheidend ist.
Ich bin ein Zuwanderer mit PPD - wo kann ich Hilfe finden?
Wenn Sie zugewandert sind und glauben, dass Sie an PPD leiden könnten, finden Sie hier einige Tipps, wie Sie Hilfe erhalten:
- Auf unserer Website finden Sie die Fragebögen der Edinburgh Postpartum Depression Scale in 17 verschiedenen Sprachen. Prüfen Sie, ob er in Ihrer Muttersprache verfügbar ist, und machen Sie den Test. Er kann eine professionelle Diagnose nicht ersetzen, ist aber ein guter erster Schritt, um einen Anhaltspunkt zu erhalten, ob man von einer PPD betroffen sein könnte.
- Suchen Sie eine Fachperson auf. Probieren Sie zunächst einen Spezialisten zu finden, der Ihre Muttersprache spricht aber geben Sie nicht auf, wenn es leider keinen geben sollte. Auf unserer Fachpersonen-Liste sind die weiteren Therapiesprachen, angegeben. Wenn Sie sich in einer anderen Sprache verständigen können (was nicht unbedingt bedeutet, dass Sie "fliessend" oder "perfekt" sprechen müssen), versuchen Sie, jemanden zu finden, der diese Sprache spricht. Wenn bei Ihnen eine Depression diagnostiziert wird, übernimmt Ihre Grundversicherung den Grossteil der Kosten für die Besuche in einer delegierten Psychotherapie sowie bei einem Psychiater.
- Beachten Sie, dass es in der Schweiz psychiatrische Kliniken gibt, die auf die Behandlung von PPD spezialisiert sind und in denen Sie zusammen mit Ihrem Kind untergebracht werden können. Mehr dazu finden Sie auf unserer Liste der MuVaKi Plätze.
- Bei Postpartale Depression Schweiz gibt es Mütter und Väter, die ebenfalls eine PPD erlebt haben und die verschiedene Sprachen sprechen. Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an (E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, Tel. 044 720 25 55) und wir werden versuchen einen passenden Kontakt für einen persönlichen Austausch zu vermitteln.
- Eine weitere Anlaufstelle ist die Mütter- und Väterberatung. Dort erhalten Sie kostenlos Unterstützung und hilfreiche Informationen rund um die Pflege Ihres Babys.
- Sprechen Sie ausserdem mit Ihrer Hebamme. Sie sind oft eine gute Informationsquelle und können Ihnen sagen, wo Sie in Ihrer Nähe Hilfe finden.
- Suchen Sie eine Selbsthilfegruppe und tauschen Sie sich mit anderen Betroffen aus. Wir bitten eine englischsprachige Gesprächsgruppe via zoom an. Wenn es an Ihrem Wohnort keine gibt, suchen Sie nach Online-Gruppen in Ihrem Herkunftsland. Das Gefühl, mit dem Problem nicht allein zu sein, ist ein wichtiger Teil der Heilung.
Autorin: Agata Siluszyk, aktives Mitglied bei Postpartale Depression Schweiz
Dieser Artikel steht auch auf Englisch zur Verfügung.
«Postpartum Depression Among Immigrants»

 Facebook
Facebook Instagram
Instagram